Keine Spur von Staub
- geschrieben von -uss
- Gelesen 1371 mal
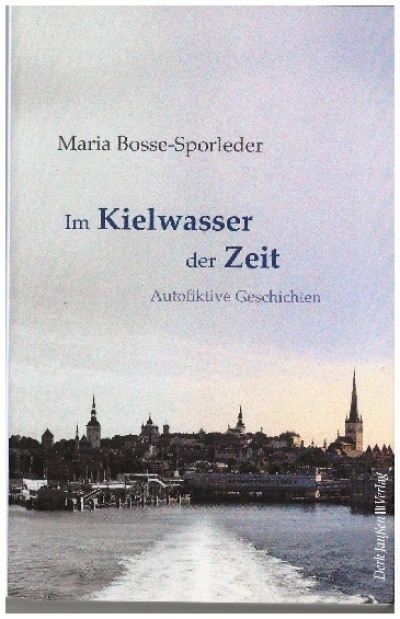
Die Autorin Maria Bosse-Sporleder spürt in fortgeschrittenem Alter in ihrem aus zahlreichen Impressionen bestehenden Buch „Im Kielwasser der Zeit“ ihrer persönlichen Geschichte und jener ihrer Familie nach.
„Sie will eine Angel auswerfen durch Zeit und Raum“, schreibt die Ich-Erzählerin. Da ist sie im Internet auf der Suche nach einem Mann, der ihr als 16-Jähriger den Kopf verdreht hat. Er ist Kunstprofessor geworden. Sie wird seinen Namen einige Jahre später nochmals eintippen und erfahren, dass er wenige Wochen zuvor gestorben ist. Glück und Leiderfahrung gehen in diesen Erinnerungen Hand in Hand.
Erstaunlich, was sie alles mit ihrer Angel aus dem Kielwasser der Zeit zieht. Beschreibt sie das Besondere im Alltäglichen? Nein. Durch die Art der Beschreibung wird das Alltägliche besonders. Die Worte sind es, die alles besonders machen. Insofern darf man diese 175 Seiten als ein Fest der Sprache erleben. Manchmal nur spürt man den Willen der Autorin, die seit vielen Jahren „Schreibwerkstätten“ leitet, eine noch treffendere Formulierung zu finden.
Die Worte also sind es, die den Geschmack im Munde wecken, wenn der Vater in der ersten der 37 kurzen Geschichten in die krosse Haut einer Hähnchenkeule beißt. In einem einzigen präzisen Satz erfährt man einige Zeilen weiter die Verortung der Familiengeschichte. „Mein Pilz“ lässt einen eine hautnahe, sinnliche Naturerfahrung miterleben, die das kleine Mädchen eher widerwillig mitmacht. Schließlich regnet es - und dann hat sie noch einen ihrer Gummischuhe (Galosch) verloren. Sehr persönliche Erinnerungen sind das. Berührend der überzeugend kindliche Blick der betagten Frau. Geschichte wird in den Geschichten lebendig. An ihrem 7. Geburtstag, einem sonnigen Tag in Estland, nehmen die deutschen Truppen Warschau ein. Fünf Wochen später ist sie mit ihrer Familie auf der Flucht.
All das und noch viel mehr erfährt man im ersten Teil des Buches, in dem sie auf der Suche nach der vergangenen Zeit ihre „Herkunft“ recherchiert. Die Genese der Sporledersippe bis zur Arbeit von Vater und Sohn als Inhaber der Seeversicherungsgesellschaft in Reval, wie Tallinn damals hieß. „Von meinen vier Großeltern ist mir Opapa am nächsten. Er war wirklich da, ich erlebte ihn“, schreibt sie. Ernst Hugo Georg Sporleder starb mit 80 Jahren 1938 in Reval. Rückblenden zum Beispiel auf die russische Großmutter Wera, eine außergewöhnliche Frau, die u.a. Wohltätigkeitsbasare ausgerichtet hat, wechseln sich ab mit Begegnungen bei den vielen Reisen, die Maria Bosse-Sporleder nach Estland unternommen hat. Zunächst mit einem vom Vater in Kanada gezeichneten Stadtplan von Tallinn. Begegnungen, die ihr wiederum Hinweise in die Vergangenheit eröffnet haben.
Die Familie ist nach dem Krieg nach Edmonton in Kanada ausgewandert. Dort verdient Ernst Sporleder den Lebensunterhalt für seine Familie als Fotograf. Tochter Maria entdeckt ihre Liebe zur Literatur, erhält eine Stipendium für die Sorbonne. Spürt, Europa ist ihre Welt. Dort genießt sie prägende Liebesbeziehungen. „Jetzt weiß ich es wieder“, hat sie eines dieser Kapitel überschrieben. Sie weiß, dass er einen „weichen, gelockten Bart“ getragen hat, als sie in Paris mit ihm im Bett war. Vieles fällt ihr noch ein. Wie die Beschreibung ihrer Mutter Elisabeth in 36 Sätzen. In seiner nüchternen Exaktheit eines der Kabinettstückchen im Kapitel „Herkunft“.
„Schwimmen lernen“ ist die erste „Begegnung“-Geschichte überschrieben. Die pubertierende Eva lernt darin nicht nur schwimmen. Eva lernt leben. Jeder Absatz beginnt mit ihrem Namen wie eine unabänderliche Feststellung. Bis sie im letzten Absatz hinter einer Kastanie mit Herzklopfen auf Vladi mit den braungebrannten Beinen wartet. Ebenso fiktiv wie die Geschichte von Brudeck und der großen gut gebauten Nachbarin. Er stürzt bei einer Wanderung ab, und sie besucht ihn im Krankenhaus. Er hat auf Bitten des Nachbars einige Tage dessen an Krücken gehenden Sohn von der Schule abgeholt, weil seine Frau plötzlich verschwunden war. Jetzt ist sie wieder da. Ihrer Kinder wegen. „Unvorstellbar, die wirklich zu verlassen.“
Rückblende. 1979 kehrt Maria Sporleder mit ihrer Schwester nach Tallinn zurück. Sie will das Haus sehen, in dem sie ihre ersten fünf Lebensjahre verbracht hat. Das zweistöckige Holzhaus macht keinen guten Eindruck. Sie wird in den folgenden Jahren noch öfters das Haus sehen, wie es immer mehr zerfällt. Bis mehr als zwei Jahrzehnte später das Haus von neuen Besitzern gründlich renoviert wird. Diese Liebe zu ihrem Geburtsland macht ihre Sorge verständlich, dass Putin nach der Ukraine auch das Baltikum wieder ins Visier nehmen könnte, wie einst die Sowjetunion.
Mit „Staub“ endet dieses Buch. Staub im Speicher unterm Dach, in den sie nicht hinaufdurfte, so lange die Mutter lebte. Sie findet neben Tagebüchern eine Karton mit säuberlich in Mappen geordneten Briefen. Deren Inhalte ihr sehr vertraut vorkommen. Eigenes Erleben entdeckt sie. Der Robert, der hier auftaucht, den hat sie doch selbst kennengelernt. Aber erinnert sie sich selbst, oder erinnert sie sich an die Geschichte, die ihre Mutter einmal geschrieben hat? Oder werden in der Erinnerung sie und ihre Mutter eine Person? Mehr Nähe geht nicht. Logisch lautet der letzte Satz: „Alles ist da.“
Maria Bosse-Sporleder: Im Kielwasser der Zeit. Autofiktive Geschichten; Derk Janßen Verlag, Freiburg i.Br. 2022, ISBN: 978-3-938871-22-5
Wolfgang Nußbaumer
(15.11.2023)